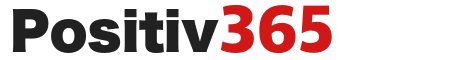Großbritannien neu beleben: Wie „Superturbinen“ die Energiewende antreiben könnten
Die Modernisierung alter Windparks in Großbritannien könnte enorme Vorteile für das Klima bringen – und das mit weniger Anlagen. Doch was geschieht mit den ausgedienten Turbinen?
Ein Blick zurück ins Jahr 2002
Damals war The Eminem Show das weltweit meistverkaufte Album, Brasilien gewann erneut die Fußball-WM, und Nokias Kult-Handy 3310 leitete eine neue Ära der mobilen Kommunikation ein. Aus heutiger Sicht wirkt dieses „Knochen“-Handy fast steinzeitlich, doch seinerzeit war es bahnbrechend. Ähnlich verhielt es sich mit den ersten Windparks, die damals in Großbritannien entstanden.
2002 war ein Meilensteinjahr für die erneuerbaren Energien: gelockerte Genehmigungsverfahren und technische Fortschritte bei Turbinen sorgten für einen Boom. Während das Nokia längst Geschichte ist, drehen sich viele jener frühen Windräder noch immer – und erreichen nun das Ende ihrer Lebensdauer.
Von der Generation 1.0 zu „Superturbinen“
Seitdem hat die Technik enorme Fortschritte gemacht. Moderne Windräder sind effizienter, intelligenter und können etwa ihre Rotorblätter selbstständig in die optimale Windrichtung stellen. Dieses Effizienzplus eröffnet eine große Chance: die sogenannte Repowering-Strategie – alte Anlagen durch leistungsstarke neue ersetzen.
„Wo wir repowered haben, konnten wir die Leistung bestehender Standorte mehr als verdoppeln“, erklärt Matthew Clayton, Geschäftsführer von Thrive Renewables, das zahlreiche britische Windparks finanziert hat. „Das ist wirklich spannend.“
Um die Klimaziele bis 2030 zu erreichen, müsste Großbritannien die Onshore-Windkraftleistung von derzeit 14 Gigawatt auf rund 30 Gigawatt steigern. Laut Clayton ließe sich ein erheblicher Teil dieses Ziels allein durch Repowering erzielen.
Weniger Anlagen, mehr Leistung
Am Standort Caton Moor in Lancaster wurden zehn alte 300-Kilowatt-Turbinen durch acht moderne 2-Megawatt-Modelle ersetzt. Ergebnis: siebenmal so viel Strom – bei weniger Anlagen. Übertragen auf andere Standorte könnte das Land sein Ausbauziel leichter erreichen, als viele vermuten.
Repowering bringt weitere Vorteile: vorhandene Netzanschlüsse und Genehmigungen können genutzt werden. Zudem sind die Anwohner Windräder bereits gewohnt – oft profitieren sie sogar durch lokale Förderfonds.
Ein Beispiel ist Lawrence Weston bei Bristol: Dort erwirtschaftet eine einzige, gemeinschaftlich betriebene Turbine bis zu 300.000 Pfund Stromerlöse pro Monat. Die Gewinne fließen in Sozialprojekte zur Armutsbekämpfung. „Das ist ein ökologischer und sozialer Gewinn zugleich“, betont Mark Pepper von der Anwohnerinitiative Ambition Lawrence Weston.
Neue Chancen – neue Herausforderungen
Die Aufhebung des faktischen Verbots für neue Onshore-Windparks im Jahr 2024 ebnet den Weg für weitere Projekte. Zwar sind moderne Turbinen größer, jedoch nicht so massiv, wie Kritiker oft befürchten. In Caton Moor etwa überragen die neuen Anlagen die alten nur um fünf Meter.
Allerdings stoßen größere Rotorblätter beim Transport durch enge Landstraßen an logistische Grenzen. Deshalb wird es auch künftig zusätzliche Standorte brauchen – Repowering allein reicht nicht aus.
Ein weiteres Hindernis: die begrenzte Kapazität des Stromnetzes. „Wir brauchen erhebliche Investitionen in die Netzinfrastruktur“, sagt James Robottom von RenewableUK.
Wohin mit den alten Rotorblättern?
Während neue Modelle bereits auf Recyclingfähigkeit ausgelegt sind, bestehen ältere Blätter aus schwer wiederverwertbarem Glasfaserverbundstoff.
Hier setzt das schottische Unternehmen Reblade an: Es verwandelt alte Rotorblätter in praktische Produkte wie Überdachungen für Ladestationen von Elektroautos, Fahrradunterstände oder sogar maßgefertigte Esstische. „Das ist Kreislaufwirtschaft im Bereich der grünen Energie“, erklärt Geschäftsführer Steven Lindsay.
Fazit
Repowering könnte nahezu im Alleingang den benötigten Beitrag der Onshore-Windkraft zur britischen Energiewende leisten. Ganz ohne neue Windparks wird es zwar nicht gehen – doch das Potenzial der „Superturbinen“ ist enorm.