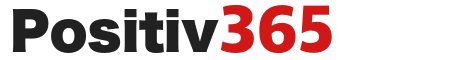Nachhaltig renovieren: Wie Bauprojekte Klima und Ressourcen schonen können
Die Europäische Union verfolgt das ehrgeizige Ziel, bis 2050 klimaneutral zu werden. Ein zentrales Handlungsfeld dabei ist der Bausektor, der allein in Deutschland rund 41 Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen verursacht. Weltweit ist die Branche sogar für rund 40 Prozent der energiebedingten CO2-Emissionen und mehr als die Hälfte des Ressourcenverbrauchs verantwortlich. Eine nachhaltige Sanierung und umweltbewusstes Bauen sind daher essenziell, um die Klimaziele von Paris zu erreichen.
Der Bausektor als Klimatreiber
Laut einem Bericht des European Academies Science Advisory Council (EASAC) entfallen 25 Prozent der Treibhausgasemissionen in Europa auf den Energieverbrauch von Gebäuden. Allein in der EU existieren rund 250 Millionen Gebäude, deren energetische Sanierung eine massive Herausforderung darstellt. Aktuell werden jedoch lediglich 1 bis 1,5 Prozent des Gebäudebestands pro Jahr renoviert. Um das Klimaziel zu erreichen, müsste diese Sanierungsrate mindestens verdoppelt werden.
Emissionen reduzieren: Bestandsgebäude erhalten statt neu bauen
Ein zentraler Hebel zur Einsparung von Emissionen liegt in der Vermeidung von Abriss. In bestehenden Gebäuden ist bereits sogenannte „graue Energie“ gespeichert – das ist die Energie, die in die Herstellung, den Transport und die Verarbeitung von Baustoffen geflossen ist. Wird ein Haus abgerissen, geht diese Energie unwiederbringlich verloren. Sanierungen statt Neubauten zu bevorzugen, ist daher eine der effektivsten Maßnahmen für den Klimaschutz im Bauwesen.
Klimafreundliche Materialien und Technologien
Moderne Gebäudesanierungen sollten auf energieeffiziente Technologien wie Dämmstoffe, Wärmerückgewinnung, Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen setzen. Auch die Auswahl der Baumaterialien spielt eine große Rolle. Recycelte oder nachwachsende Rohstoffe wie Holz, Hanf, Kork oder Lehm verursachen deutlich weniger CO2 als konventionelle Materialien wie Beton oder Stahl. Holz hat darüber hinaus den Vorteil, dass es Kohlendioxid aus der Atmosphäre bindet und damit einen positiven Beitrag zur CO2-Bilanz leistet.
Der Problemfall: Beton
Beton ist weltweit der am häufigsten verwendete Baustoff, allerdings auch einer der klimaschädlichsten. Bei der Produktion von Zement, dem Hauptbestandteil von Beton, entstehen hohe CO2-Emissionen. Pro Tonne Zement werden rund 600 Kilogramm CO2 freigesetzt. Eine echte Alternative fehlt bislang, doch die Baubranche setzt verstärkt auf Recyclingverfahren, um die Klimabilanz zu verbessern.
Kreislaufwirtschaft im Bauwesen
Ein zukunftsfähiger Ansatz ist das kreislauffähige Bauen. Dabei werden Baumaterialien so ausgewählt, dass sie wiederverwendet oder recycelt werden können. Das Kreislaufwirtschaftsgesetz verpflichtet Hersteller seit 2020, langlebige und reparaturfähige Baustoffe zu entwickeln. Ziel ist es, den jährlich anfallenden 228 Millionen Tonnen Bau- und Abbruchabfällen in Deutschland entgegenzuwirken. Die Wiederverwertung von Materialien reduziert nicht nur Abfall, sondern spart auch Primärrohstoffe und Energie.
Quartiersansatz statt Einzelobjekte
Ein nachhaltiger Perspektivwechsel in der Stadtplanung setzt auf den Quartiersansatz. Anstatt Gebäude isoliert zu betrachten, werden ganze Wohnviertel energetisch optimiert. Das ermöglicht gemeinsame Energieversorgungslösungen, effizientere Sanierungsprozesse und eine bessere Nutzung erneuerbarer Energien. Diese Herangehensweise fördert eine ganzheitliche Planung und beschleunigt die sogenannte Wärmewende.
Fazit: Nachhaltigkeit beim Renovieren zahlt sich aus
Wer klima- und ressourcenschonend renovieren möchte, sollte auf den Erhalt bestehender Bausubstanz, den Einsatz ökologischer Materialien und energieeffiziente Technologien setzen. Eine Kombination aus Sanierung, Kreislaufwirtschaft und intelligentem Quartiersmanagement kann nicht nur die Umwelt entlasten, sondern auch langfristig Kosten senken. Bauherren, Architekten und Planer sind gefordert, bei jedem Projekt den CO2-Fußabdruck zu minimieren – für eine klimaneutrale Zukunft im Sinne des Pariser Abkommens.