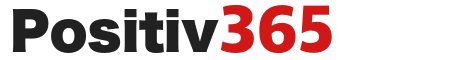Studie zeigt: Elektroautos belasten Stromnetze weniger als befürchtet
Mit dem Ziel, bis 2030 rund 15 Millionen Elektrofahrzeuge auf Deutschlands Straßen zu bringen, wächst die Sorge vor möglichen Überlastungen des Stromnetzes. Denn jede private Wallbox erhöht den Energiebedarf deutlich – besonders in Stoßzeiten. Doch eine neue Analyse aus Baden-Württemberg zeigt, wie sich Stromausfälle durch intelligentes Lademanagement vermeiden lassen.
Millionen Wallboxen – steigender Strombedarf im Wohngebiet
Immer mehr Haushalte rüsten auf Elektromobilität um. Allein ein staatliches Förderprogramm verzeichnete über 800.000 Anträge für private Ladepunkte. Eine Wallbox kann jedoch mit bis zu 22 Kilowatt Ladeleistung deutlich mehr Strom ziehen als herkömmliche Haushaltsgeräte. Wenn viele E-Autos gleichzeitig geladen werden – etwa nach Feierabend – drohen lokale Netzüberlastungen, warnen Stromnetzbetreiber.
Auch die Bundesnetzagentur sieht Handlungsbedarf: Wärmepumpen und E-Autos bringen hohe Anschlussleistungen mit sich – und diese werden zunehmend zeitgleich abgerufen. Es braucht daher sowohl einen schnellen Netzausbau als auch intelligente Steuerungsmöglichkeiten zur Netzstabilisierung. Genau hier setzen die Ergebnisse eines Pilotprojekts von Netze BW, dem Netzbetreiber der EnBW, an.
Praxisversuche liefern konkrete Lösungen
In sogenannten „Netzlaboren“ testete Netze BW über mehrere Jahre hinweg reale Szenarien: In acht ausgewählten Wohngebieten luden 113 Haushalte ihre E-Autos unter Alltagsbedingungen. Dabei untersuchten Fachleute, wie viele Fahrzeuge gleichzeitig geladen wurden und welche Belastung dies für das Stromnetz bedeutete.
Das Ergebnis: Die befürchtete 100-prozentige Gleichzeitigkeit trat nicht ein. Im Durchschnitt luden nur etwa 50 % der Fahrzeuge gleichzeitig, in Spitzenzeiten maximal 88 %. Technikchef Martin Konermann zeigt sich erleichtert: Hätte es eine vollständige Überschneidung gegeben, wäre der Netzausbau deutlich aufwendiger und teurer ausgefallen.
Netzdienliches Laden als Schlüssel zur Entlastung
Kern der Lösung ist das sogenannte netzdienliche Lademanagement. Wenn zu viele E-Autos gleichzeitig am Netz hängen, wird die Ladeleistung temporär reduziert, um Stromspitzen abzufedern. Das bedeutet: Das Laden dauert länger – aber die Versorgungssicherheit bleibt erhalten. Zwei Ansätze wurden getestet:
- Statisches Lademanagement: feste Ladezeitfenster mit reduzierter Leistung, z. B. abends nur 50 %.
- Dynamisches Lademanagement: automatische Anpassung je nach aktueller Netzlast – benötigt allerdings moderne Messtechnik.
Laut Projektleiter Markus Wunsch bemerkten die meisten Teilnehmenden kaum Einschränkungen. Die Fahrzeuge waren am nächsten Morgen vollständig geladen, die Ladedauer verlängerte sich im Schnitt um weniger als eine Stunde.
Gesetzliche Grundlage ab 2025 geplant
Die Erkenntnisse sollen bald auch gesetzlich verankert werden: Ab dem kommenden Jahr ist ein neuer Gesetzespassus geplant, der Netzbetreibern das zeitweise Reduzieren der Ladeleistung ermöglicht – gegen einen möglichen finanziellen Ausgleich für die Verbraucher:innen. Ziel ist es, Freiwilligkeit zu fördern, aber im Notfall auch verbindliche Vorgaben zu ermöglichen.
Verbraucherschützer fordern klare Regeln: Eingriffe ins Ladenetz dürften nicht zur Regel werden, sondern nur gezielt und transparent angewendet werden. Thomas Engelke vom Verbraucherzentrale Bundesverband betont: „Es darf keine pauschale Freigabe für tägliche Einschränkungen geben.“
Fazit: Elektroautos brauchen smarte Netze – nicht zwingend mehr Leistung
Stromnetze und Elektromobilität müssen gemeinsam gedacht werden. Die Studienergebnisse aus Baden-Württemberg zeigen, dass durch intelligente Steuerung und gutes Timing Millionen Elektrofahrzeuge ohne größere Probleme integriert werden können – ohne das Netz zu überlasten. Wichtig bleibt, dass Verbraucher:innen mitgenommen werden und neue Technologien fair, sicher und transparent eingeführt werden.